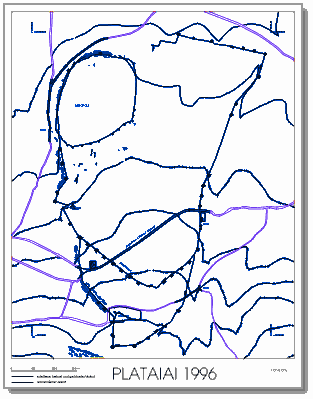
| Forum Archaeologiae - Zeitschrift für klassische Archäologie 6 / III / 1998 |
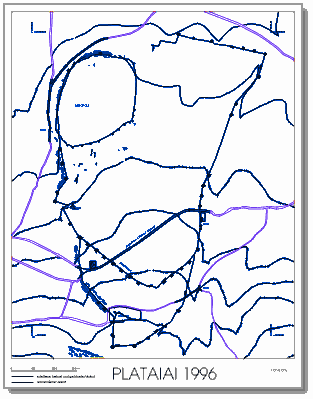
|
Die antike Stadt erstreckte sich, anhand ihrer Befestigungsanlagen großteils eingrenzbar, über ein Gebiet von etwa 0,85 km2 (vgl. Abb. 1). Im Nordwesten des ummauerten Gebiets liegt ein sanfter Hügel mit einer Fläche von annähernd 120.000 m2, der rundum befestigt war und als Akropolis bezeichnet werden kann. Von seiner Westflanke läuft entlang eines Gießbachtals eine Befestigungslinie nach Süden bis knapp vor den felsigen Abhang des Kithairon. Sie knickt dort nach Osten um, ändert ihre Richtung nach einer kurzen Strecke nochmals und streicht mehr als einen Kilometer nach Nordnordost entlang der Oberkante eines weiteren Gießbachtals. Eine von Osten nach Westen eine sanfte Senke, einen Höhenrücken und die den Akropolishügel im Osten begrenzende Mulde querende Mauer bildete den nördlichen Abschluß der antiken Siedlung. |
Die Arbeiten vor Ort begannen im Spätherbst 1996 mit der geodätischen Dokumentation der obertägig erhaltenen Befestigunsanlagen von Plataiai. Da uns weder GPS noch die umfangreiche Ausrüstung, die zur Etablierung eines terrestrischen Netzes notwendig gewesen wäre, zur Verfügung standen, mußte als Grundlage ein Ringpolygon genügen. Erfahrungen an anderen Grabungs- und Surveystätten lehren, daß die mit einem derartigen Procedere erzielbare Genauigkeit mehr als ausreichend für archäologische Zielsetzungen ist und ein solches Vorgehen demnach einen gesunden Kompromiß zwischen Genauigkeitsansprüchen einerseits und ökonomischem Vorgehen andererseits bieten konnte. Die Vermessungsarbeiten wurden durch die fast ebene, baumfreie Geländekonfiguration des Platzes begünstigt. Das entlang des großen Mauerrings verlaufende Ringpolygon umfaßte 8 Polygonpunkte mit Polygonzugsseiten zwischen etwa 100 und 500 m, die Berechnung in einem lokalen Koordinatensystem erbrachte im Abschluß einen Lagefehler von wenig mehr als 0,01 m und einen Winkelfehler von 3 mgon. Der Höhenfehler betrug 0,12 m, was aber, besonders für die Zielsetzungen eines Field-Surveys, als irrelevant betrachtet werden kann.
Zusätzlich zum Ringpolygon wurde entlang der Südkante der Akropolis ein weiterer Polygonzug gelegt, um auch in diesem Gebiet der Siedlung Meßpunkte zur Verfügung zu stellen. Die so erreichte Fixpunktdichte war mehr als zufriedenstellend. Die Einmessung dreier markanter Dachreiter auf Kirchen und Kapellen der Umgebung durch Vorwärtsschnitte von mehreren Polygonpunkten aus diente der Bestimmung von Fernzielen, was sich im Zuge der weiteren Arbeiten bewährte. Da wir ohne Funkgeräte arbeiteten, waren wir gezwungen, die Distanzen bei der tachymetrischen Aufnahme nicht weit über 100 m steigen zu lassen, um Mißverständnisse zwischen Theodolit und Skizzenführung zu vermeiden. Das konnte nur erreicht werden, indem zwischen den vorhandenen Fixpunkten Gerätestandpunkte mittels freier Stationierungen bestimmt wurden. Auch dieses Procedere, bei dem die Fernziele sofort Verwendung fanden, hat sich bewährt. Die Aufnahme der etwa 1500 Detailpunkte erfolgte synchron mit der Einmessung der Polygonpunkte, die Resultate wurden in Wien am Institut für Klassische Archäologie an der Universität Wien ausgewertet und ein Lageplan unter AutoCad erstellt. Die geodätische Dokumentation der Mauern von Plataiai beanspruchte die gesamte zehntägige Kampagne von 1996.
Die Kampagne 1997 war dem genaueren Studium der Befestigungsanlagen gewidmet. Zusätzlich begann ein Keramiksurvey, dessen Resultate nach Auswertung des Materials helfen sollen, Fragen zur Chronologie der Stätte zu beantworten.
Das ausgedehnte Areal von Plataiai gliedert sich in mehrere Teile, die, schon ausweislich der in unterschiedlichen Stilen und Techniken errichteten Mauern, zu verschiedenen Zeitpunkten in das Gebiet der Stadt eingegliedert wurden. Die Analyse des keramischen Materials kann zumindest grobe Anhaltspunkte zum Beginn der Siedlungstätigkeiten in den verschiedenen Abschnitten liefern. Da unsere Mittel und auch die für die Arbeiten zur Verfügung stehende Zeitspanne allerdings beschränkt waren, mußte der Keramiksurvey auf einige ausgewählte Flächen des ummauerten Gebiets beschränkt werden.
Die vorläufigen Resultate der bis jetzt durchgeführten Arbeiten können kurz wie folgt zusammengefaßt werden:
Plataiai war, wie schon von Kirsten und Fossey festgestellt und auch durch Fundkeramik belegt, seit dem Frühhelladikum besiedelt. Mittelhelladische und mykenische Keramik begegnen ebenso. Die bis dato ermittelten Areale vorgeschichtlicher Siedlungstätigkeit beschränken sich in ihrer Masse auf den westlichen Bereich des Akropolishügels und sind alleine in Keramikfunden faßbar. Ein Fragment einer Obsidianklinge aus dem Ostbereich des großen Peribolos belegt allerdings weitergespannte vorgeschichtliche Aktivitäten am Ort. Archaische Keramik findet sich nur im Akropolisbereich. Zu einem Zeitpunkt während der späten Archaik oder der frühen Klassik wurde dann die Akropolis befestigt. Spärliche Reste einer in lesbischem Stil[2] errichteten Stadtmauer erstrecken sich entlang der Westkante des Hügels (Abb. 2), einige Blöcke dieser Mauer konnten auch, weit verschleppt, in der Umgebung geortet werden.


Abb. 2: Plataiai. Lesbische Mauer an der Westkante der Akropolis
Abb. 3: Plataiai. Außenschale des großen Peribolos an der Nordflanke


Abb. 4: Plataiai. Turm im Verlauf des Diateichismas
Abb. 5: Plataiai. Turm im Verlauf der späten Spolienmauer
Dank ergeht an das griechische Kultusministerium für die großzügige Erteilung einer Arbeitsgenehmigung und an den Ephoros von Boiotien, Herrn V. Aravantinos für die generöse Unterstützung, die das Surveyteam von seiner Seite erfuhr. Der Demos von Plataies, insbesondere sein Bürgermeister, brachten den Arbeiten ihr Interesse und ihre Hilfsbereitschaft entgegen. Das ÖAI Wien, vertreten durch Herrn Univ. Prof. Dr. F. Krinzinger und das ÖAI Athen, vertreten durch Frau Dr. V. Mitsopoulou-Leon, gewährten der Unternehmung ihre freundliche Unterstützung. Herr Ing. P. Glass, Generalvertreter Wien der Firma Geodimeter, ermöglichte die geodätische Dokumentation von Plataiai, indem er uns eine Totalstation Geodimeter 420 samt Zubehör für die Dauer der Arbeiten zur Verfügung stellte. Die Unterstützung, die Hilfe und das Interesse, die dem Projekt von diesen Personen und Institutionen entgegengebracht wurden, seien an dieser Stelle gebührend gewürdigt. Die Arbeiten in Plataiai sollen fortgesetzt werden.
[1] A. Skias, Prakt 1899, 42 ff.; H. S. Washington u.a., AJA 5, 1989, 439 ff.; dies., AJA 6, 1890, 445 ff.; dies., AJA 7, 1991, 390 f.; E. Kirsten, RE XX (1950) 2255 ff., s.v. Plataiai; J. M. Fossey, Topography and Population of Ancient Beotia (1986) 102 ff.; (dort auch weitere Lit.).
[2] vgl. W. Wrede, Attische Mauern (1933) 40 ff.; R. L. Scranton, Greek Walls (1941) 25 ff.; F. E. Winter, Greek Fortifications (1971) 80ff.; C. Krause, Eretria IV. Das Westtor (1972) 30 ff.
[3] Frau Dr. V. Mitsopoulou-Leon nahm sich die Mühe, meine Keramikzeichnungen zu sichten und gab mir wertvolle Hinweise zur Datierung des Materials.
[4] Frau J. Vroom sei an dieser Stelle für ihren Hinweis auf die späte Datierung einiger glasierter Scherben aus Plataiai gedankt.
© A. Konecny